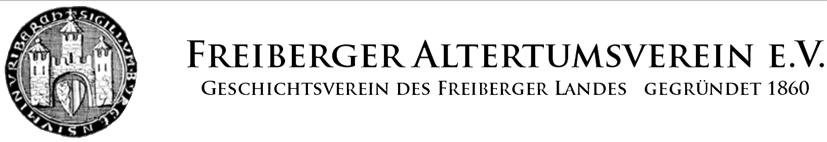
Andreas - Möller - Geschichtspreis
- Publikationen
- weitere Publikationen
Die jährlichen Verleihungen des Andreas- Möller- Geschichtspreises werden jeweils von drei Vorträgen umrahmt, die einem bestimmten Thema gewidmet sind. Im Jahr 2002 widmeten sich die Vorträge anlässlich des Forschungsprojektes zu den renaissancezeitlichen Musikinstrumenten einzelnen Aspekten der kurfürstlichen Begräbniskapelle im Freiberger Dom. Im Jahr 2003 war anlässlich des 250. Jahrestages der Wiedereinweihung der Nikolaikirche Freiberg nach dem Barockumbau im Jahr 1753 die Baugeschichte dieses Sakralbaus das Thema der Preisverleihung. Im Jahr 2004 stand der im 19. Jahrhundert angelegte Rothschönberger Stolln im Mittelpunkt, nachdem dieser nach den Hochwasserschäden des Jahres 2002 saniert worden ist. Die feierliche Preisverleihung 2005 stand ganz im Zeichen des großen Renaissance- Humanisten Georgius Agricola. Sie fügte sich thematisch in die zahlreichen Aktivitäten zu seinem 450. Todestag. Im März 2006 wurde der Andreas - Möller -Geschichtspreis mit der ersten nationalen Auszeichnung der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe für Stiftungen prämiert. Die Ehrung "David 2006" erlebte damit ihre Premiere und wird künftig an Projekte verliehen, die mit einem kleinen Finanz-Budget sehr erfolgreich sind.

Die Vorträge der Preisverleihungen der Jahre 2002 und 2003 sind in einer Publikation zusammengefasst worden, die am 30. Oktober 2004 zur Preisverleihung erschien. Das insgesamt 130 Seiten umfassende Heft vereint somit sechs Aufsätze zu vorwiegend bau- und kunstgeschichtlichen Themen. Mit 20 Farbabbildungen auf acht Farbtafeln und 99 schwarz-weiß-Abbildungen ist die Publikation ansprechend ausgestattet. Im Folgenden werden die einzelnen Aufsätze kurz vorgestellt:
Claudia Kunde: Die Begräbniskapelle der albertinischen Wettiner im Freiberger Dom, S. 11-32
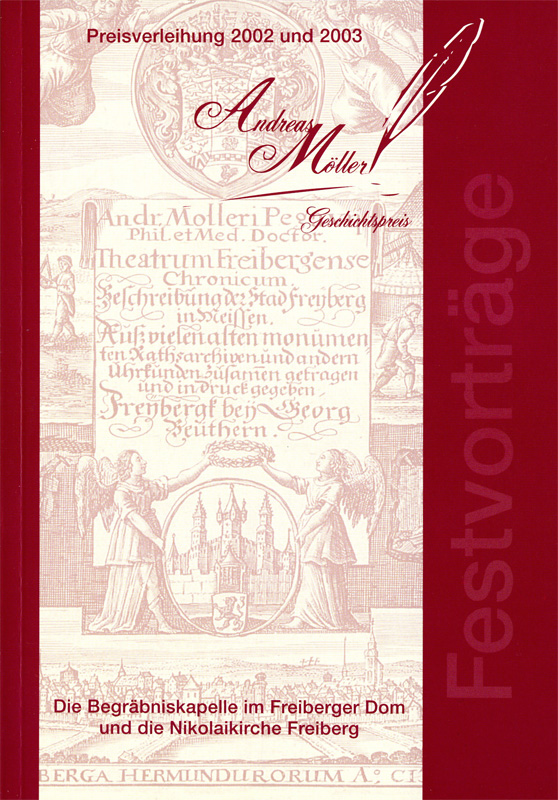 Download |
|
Die Begräbniskapelle gehört zu den bedeutendsten Bauwerken der Renaissance nördlich der Alpen. Sie wurde in der Zeit von 1585 bis 1594 von führenden europäischen Künstlern wie Giovanni Maria Nosseni und Carlo die Cesare del Palagio und einheimischen Meistern gestaltet. Bereits vor der Anlegung der Begräbniskapelle war mit dem im Jahr 1541 verstorbenen Herzog Heinrich der erste evangelische Wettiner hier bestattet und damit die neue Grablege eröffnet worden. Sein im Jahr 1553 in der Schlacht bei Sievershausen gefallener Sohn Kurfürst Moritz erhielt mit dem nach Entwürfen von Gabriel und Bendetto Thola ein bereits 1559-1562 von Antonius von Zerroen gefertigtes Freigrab, das sogenannte Moritzmonument, das ebenfalls ein international bedeutendes Renaissancekunstwerk ist. Die derzeit an ihrer Dissertation arbeitende Kunsthistorikerin geht vor allem dem Funeralwesen dieser Zeit nach und erläutert anhand des Begräbnisses von Kurfürst Christian I. (1560-1591) einige wesentliche Aspekte. |
Andreas Schulze: Die Figurine des Kurfürsten Moritz aus dem Freiberger Dom, S. 33-51
Kurfürst Moritz, der im Jahr 1553 nach einer in der Schlacht bei Sievershausen erlittenen Verletzung verstorben war, erhielt auf Veranlassung seiner Bruders August ein prächtiges Grabmal. In den letzten Jahrzehnten stand hingegen ein Objekt nicht so sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit, da sich dieses seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zur Restaurierung in Dresden befand - die so genannte Moritzfigurine. Sie wurde wahrscheinlich unmittelbar nach dem Tod von Moritz geschaffen und trägt die Rüstung, die dieser in der Schlacht trug und die das tödliche Einschussloch im Rücken aufweist. Der Autor, der als Restaurator im Landesamt für Denkmalpflege Sachsen tätig ist, geht der interessanten Geschichte der Figurine nach und erläutert die einzelnen, teilweise höchst komplizierten Restaurierungsschritte. So war es möglich, die Figurine erstmals seit Jahren wieder im Rahmen der Landesausstellung in Torgau der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Eszter Fontana und Veit Heller: Musikinstrumente in Engelshand. Ein Forschungsprojekt zu den Renaissanceinstrumenten in der Begräbniskapelle des Freiberger Domes, S. 53-59
Die beiden Autoren vom Musikinstrumentenmuseum Leipzig leiten das Forschungsprojekt zu den Musikinstrumenten, die den Engeln auf dem obersten Sims der Begräbniskapelle im ausgehenden 16. Jahrhundert in die Hände gegeben worden sind. Nachdem bereits im Jahr 1884 Richard Steche erkannt hatte, dass es sich zumindest bei einigen der Instrumente um spielbare Originale und nicht etwa um Attrappen handelt, waren diese immer wieder Gegenstand der Forschung. Durch Zettel in einigen der Geigen war beispielsweise bekannt, dass sie von der Geigenbauerfamilie Klemm aus Randeck bei Freiberg stammen. Jedoch erst im Jahr 2002 ergab sich die Gelegenheit, die Instrumente in ihrer Gesamtheit mit verschiedenen Partnern nach neuesten wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen und zu analysieren. So entstanden auch millimetergenaue Kopien der Instrumente die in einer spektakulären Aufführung am 15. Mai 2004 im Freiberg Dom erstmals zu hören waren, nachdem Veit Heller in einem Vortrag in der Nikolaikirche einige der für die Musizierpraxis des späten 16. Jahrhunderts nicht zu unterschätzenden neue Erkenntnisse erläutert hatte.
Uwe Richter: Die Freiberger Nikolaikirche - Historische Einordnung und Ergebnisse archäologischer Grabungen, S. 61-77
Der damals als Stadtarchäologe tätige Historiker und Ur- und Frühgeschichtler Uwe Richter stellt die von ihm geleiteten Ausgrabungen in der Nikolaikirche vor, die von 1990 bis 1994 stattfanden. Die bemerkenswerte Erkenntnis zweier romanischer steinerner Vorgängerbauten mit beachtlichem plastischen Bauschmuck gehört dabei zu den wichtigsten Ergebnissen der archäologischen Untersuchungen. Darüber hinaus geht der Autor der Geschichte dieses Sakralbaus von seiner Gründung in der Zeit um 1170 bis zum Abschluss der grundlegenden Sanierung im Jahre 2002 nach und setzt diese in Beziehung zu den Bautätigkeiten an der Nikolaikirche. Für die Geschichte der Reformation in Freiberg ist weiterhin interessant, dass der erste öffentliche evangelische Gottesdienst in Freiberg im Jahr 1533 in dieser Kirche noch vor der Einführung der Reformation in den Ämtern Freiberg und Wolkenstein im Jahr 1537 stattfand.
Heinrich Magirius: Die bau- und kunstgeschichtliche Bedeutung der Nikolaikirche Freiberg zur Zeit der Romanik und Gotik, S. 79-102
Auf der Grundlage der Ergebnisse der archäologischen und bauarchäologischen Untersuchungen geht der Autor den einzelnen baulichen Aspekten und Abhängigkeiten der drei Steinbauten der Nikolaikirche Freiberg nach. Der Vergleich mit den anderen Freiberger Kirchen erweist sind dabei ebenso aufschlussreich wie der überörtliche Vergleich mit dem Kirchenbau in Obersachsen im Mittelalter. Die umfassende Kenntnis der Bau- und Kunstgeschichte Mitteldeutschlands (und darüber hinaus) des langjährigen sächsischen Denkmalpflegers und Kunsthistorikers kommt dem Forschungsgegenstand ebenso zu Gute wie seine Fähigkeit solche Bauwerke in allgemeine Entwicklungen einzuordnen und
Besonderheiten sowie Neuerungen zu erkennen.
Mario Titze: Der barocke Umbau der Freiberger Nikolaikirche und ihre Ausstattung, S. 103-121
Der Kunsthistoriker, dessen Dissertation über "Das barocke Schneeberg" kürzlich im Druck erschienen ist, erweist sich einmal mehr als hervorragender Kenner barocker Kunstgeschichte Mitteldeutschlands. Der Barockumbau der Nikolaikirche unter Leitung des Freiberger Ratszimmermeister Johann Gottlieb Ohndorff erfolgte unter wesentlicher Beteiligung von Dresdner Hofkünstlern. So erscheinen in den Akten beispielsweise der Oberlandbaumeister Johann Christian Knöffel - der Baumeister des sächsischen Rokoko - der Hofbildhauer Gottfried Knöffler und der Hofmaler Christian Wilhelm Ernst
Dietrich. Der Autor versteht es, die teilweise schwer zu interpretierenden archivalischen Belege mit den tatsächlich vorhandenen Werken zu verbinden, so dass ein geschlossenes Bild von den jeweiligen Anteilen der Dresdner und der örtlichen Künstler, wie vor allem der Bildhauer Johann Gottfried Stecher aus Hainichen, am Kirchenbau und der Ausstattung der Freiberger Nikolaikirche entsteht.
Die Vorträge der Preisverleihungen der Jahre 2004 und 2005 sind in einer zweiten Publikation zusammengefasst worden. Sie erschien am 18. November 2006. Auf 112 Seiten mit 5 Übersichtsskizzen sowie 39 schwarz-weißen- und 12 farbigen Abbildungen werden 6 Aufsätze präsentiert.
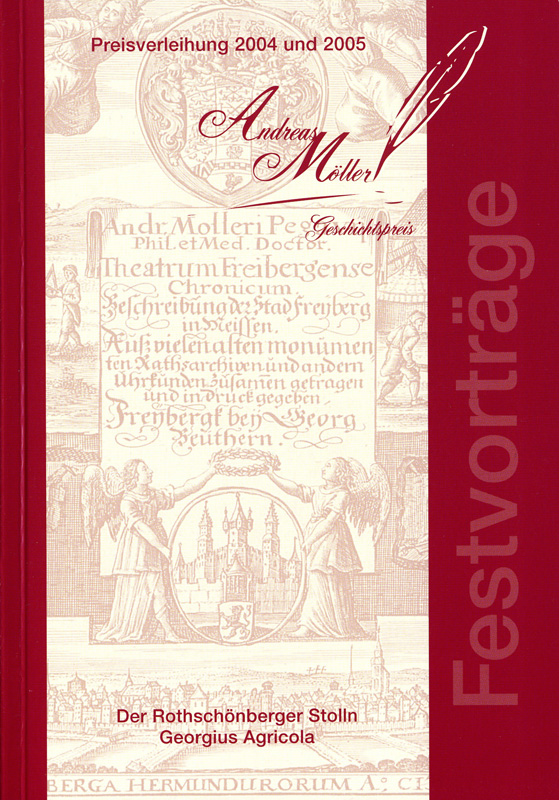 Download |
|
Die Vorträge der Preisverleihungen der Jahre 2006 und 2007 sind in einer dritten Publikation zusammengefasst worden. Sie erschien am 8. November 2008. Auf 92 Seiten werden die Laudationes für 6 Preisträger und 5 geschichtliche Aufsätze präsentiert.
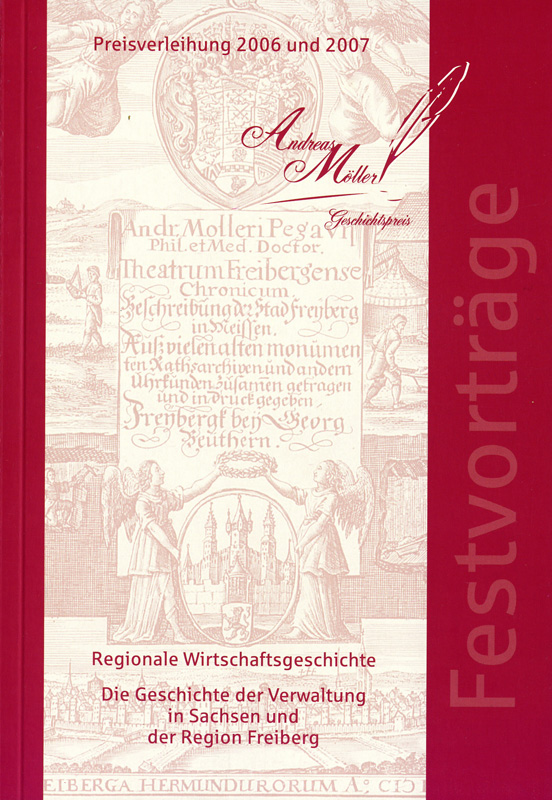 Download |
|
Die Vorträge der Preisverleihungen der Jahre 2008 und 2009 sind in einer vierten Publikation zusammengefasst worden. Sie erschien am 6. November 2008. Auf 118 Seiten werden die Laudationes für 6 Preisträger und 5 geschichtliche Aufsätze präsentiert.
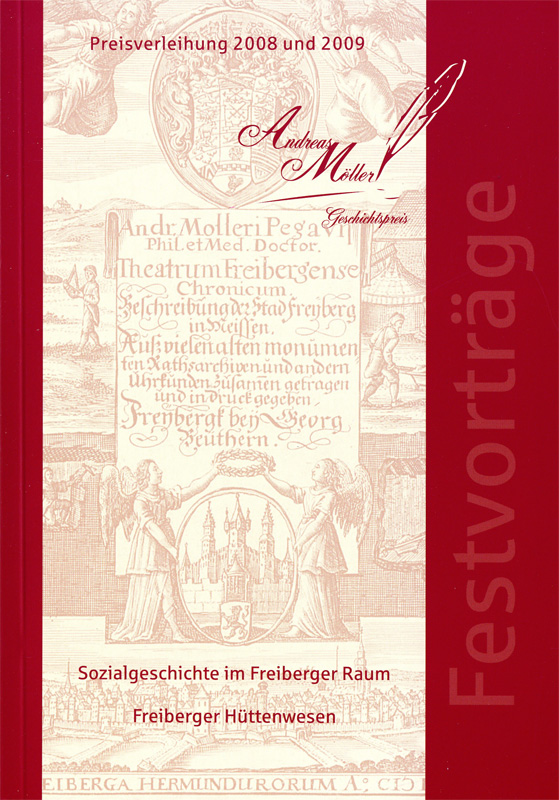 Download |
Richter, Uwe: Städtische Gesundheits- und Fürsorgeeinrichtungen in Freiberg vom 13. bis 19. Jahrhundert mit einem Exkurs zum Hospitalneubau 1668/71, S. 21- 44 |
Die Vorträge der Preisverleihungen der Jahre 2010 bis 2012 sind in einer fünften Publikation zusammengefasst worden. Sie erschien 2013.
Auf 155 Seiten werden die Laudationes für 9 Preisträger und 6 geschichtliche Aufsätze präsentiert.
|
|
Herholz, Helmut: Neuigkeiten zu den "Goldprägungen" in Freiberg Mitte des 16. Jahrhunderts, S. 31- 42 |
Die Vorträge der Preisverleihungen der Jahre 2013 und 2014 sind in einer sechsten Publikation zusammengefasst worden. Sie erschien 2015.
Auf 81 Seiten werden die Laudationes für 8 Preisträger und 4 geschichtliche Aufsätze präsentiert.
|
|
|
Richter, Wolfgang: Zur Geschichte der Lehrerbildung in Mittelsachsen, S. 29- 40 |
Die Vorträger der Preisverleihungen der Jahre 2015 und 2016 sind in einer siebten Publikation zusammngefasst worden. Sie erschien 2017.
Auf 55 Seiten werden die Laudationes für 7 Preisträger und geschichtliche Aufsätze präsentiert.
|
|
|
Thiel, Ulrich: Betrachtungen zur Wassernutzung im Landkreis Mittelsachsen in der Vergangenheit. S. 39- 55
|



